Face the players! Europäische Patrioten verjagen!
Für das Wochenende vom 19. bis 21. September 2008 lädt die extrem rechte Bürgerbewegung pro Köln die europäische Rechte zu einem »Anti-Islam-Kongress« nach Köln ein. Die angekündigten TeilnehmerInnen des Kongresses gleichen einem Line-up des Grauens: So sollen angeblich mehrere »Patriotische Gäste« aus der BRD, wie Harald Neubauer (Herausgeber von Nation & Europa) oder der Bundestagsabgeordnete Henryk Nitzsche (ehemals CDU) sowie aus den europäischen Ländern: die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), der belgische Vlaams Belang, der Front National (FN) aus Frankreich, Alsace d’abord (Das Elsass zuerst), Die Freiheitlichen aus Südtirol, die British National Party (BNP) aus England, die Lega Nord aus Italien sowie extreme Rechte aus dem ehemaligen Jugoslawien, Ungarn usw. ihr Stelldichein geben.
Die extreme Rechte jubelt bereits im Vorfeld, dass »Deutschland eine solche Veranstaltung von rechts noch nie gesehen habe!«. Und ganz Unrecht haben sie nicht: Die Dimension ist nicht nur eine neue durch die erwartete Teilnahme extremer Rechter aus ganz Europa, sondern auch die Thematik »Anti-Islam« scheint den Kern des Zeitgeistes zu treffen. Die Ressentiments gegen MuslimInnen nehmen in den letzten Jahren in Europa immer weiter zu. Laut Heitmeyer-Studie aus dem Jahre 2006 würden zweiundzwanzig Prozent der Befragten am liebsten gar keine MuslimInnen in Deutschland haben und dreiunddreißig Prozent fühlten sich durch die vielen MuslimInnen manchmal wie Fremde im eigenen Land. So wundert es kaum, dass die extreme Rechte das Thema für sich entdeckt hat und nun um im Namen einer vermeintlichen Islamkritik ihre rassistischen Plattitüden von sich gibt. Ganz neu ist die Begeisterung der Rechten für das Thema »Anti-Islam« jedoch nicht: Bereits 1983 feierte z.B. Jean-Marie Le Pen (FN) seinen politischen Durchbruch und seine ersten Wahlerfolge mit Bedrohungsvorstellungen, die sich um den Islam drehten.
Inzwischen ist vor allem Anti-Moscheebau zu einem Thema der extrem Rechten in Europa geworden. Moscheen werden als »Unterschlupf für Islamisten« bezeichnet, die über kurz oder lang die Herrschaft übernehmen wollten und die eigene »christlich-abendländische Kultur« sei durch »muslimische Überfremdung« bedroht. Auch in anderen europäischen Ländern werben extrem rechte und (post)-faschistische Parteien usw. mit anti-islamischen Parolen. So fordert die FPÖ ein Verbot für Minarette und ihr Vorsitzender Strache spricht davon, dass der Kampf der Kulturen bereits begonnen habe und der Islamismus der Faschismus des 21. Jahrhunderts sei.
»Anti-Islam« als Thema hat Hochkonjunktur; den rechten Gruppierungen geht es aber nicht darum, sich kritisch mit dem Islam auseinanderzusetzen, sondern auf diesem Wege rassistische und nationalistische Inhalte zu transportieren und die Bevölkerung an sich zu binden. Fatal ist allerdings, dass bei einem Teil der Bevölkerung Europas diese »Anti-Islam-Kampagnen« auf Zustimmung stoßen. Diesen zunehmenden gesellschaftlichen Ressentiments gegenüber dem muslimischen Bevölkerungsanteil sowie der Ausweitung rechtspopulistischer Elemente im politischen Geschäft Europas scheinen weder das kaum noch wahrzunehmende links-liberale Bürgertum noch die antifaschistische Bewegung etwas entgegen setzen zu können. Diverse Gegenmobilisierungen zu Aktionen der extremen Rechten, welche sich gegen den »Islam« richteten, verliefen eher zurückhaltend oder gar nicht. Die Ursache liegt weniger an den spezifischen Akteuren der extremen Rechten, als an der politischen Bewertung der »Anti-Islam-Kampagnen«. Die Kritik am Islamismus sowie die Kritik an Antisemitismus und Patriarchat im Kontext des Islams scheinen mit einer antirassistischen Positionsbestimmung unvereinbar zu sein. Vor allem dann, wenn eine Kritik zum Phänomen rassistischer Hetze, codiert in einer vermeintlichen Islamkritik, Stellung beziehen soll.
No racism!
Jeder Rassismus basiert auf der Konstruktion grundlegender Wesensunterscheidungen angeblicher Kollektividentitäten im Schema eines »Anderen« und eines »Selbst«. Diese Identitäten entstehen aus Macht- bzw. Nicht-Machtpositionen innerhalb gesellschaftlicher Widersprüche, wie dem Lohnarbeitsverhältnis, Patriarchat oder der möglichen oder unmöglichen Wahrnehmung »sozialer Rechte« (Bildung, Gesundheit usw.).
Die verschiedenen Rassismen sind durch ihre historische Entstehung, ihre ideologische Herleitung, sowie in ihren gesellschaftlichen Funktionen unterschiedlich. Der moderne Antisemitismus ist mit dem postkolonialen Rassismus nicht identisch, auch wenn beide ihren grundlegenden Ursprung in der Durchdringung der gesellschaftlichen Sphären durch das kapitalistische Wertprinzip haben. Die als »Andere« Konstruierten erscheinen als die willenlosen Objekte des Marktes, als Verkörperung des Gebrauchswerts, als gezähmte und doch unzähmbare Natur, während die »Juden« als mächtige Repräsentanten des Marktes, als Verkörperung des Tauschwertes, erscheinen. Die dominierenden Ausdrucksformen des Rassismus haben in den letzten Jahren in Europa eine »Modernisierung« erfahren. Anfang der 1990er Jahre war noch der »klassische« biologistische und völkische Rassismus selbst in der so genannten Mitte der Gesellschaft vorhanden. Im Rahmen der Transnationalisierung der Kapital-Akkumulation (»Globalisierung«) nahmen Wohlstandschauvinismus sowie Standortnationalismus zu. Dass »Ausländer die Arbeitsplätze wegnehmen und unsere Sozialsysteme unterwandern«, wusste spätestens im Rahmen der Debatte um die Abschaffung des Asylgesetzes 1993 auch der/die letzte GenossIn innerhalb der SPD. Die Kulturalisierung des Selbst und der Anderen wurde fast hegemonial.
Soziale Konflikte werden als »Kampf der Kulturen« gedeutet. Im Namen einer »multikulturellen Gesellschaft« wird eine staatliche »Fremdkulturalisierung«, wie im jüngsten Beispiel Schäubles Islamkonferenz zu sehen, vorangetrieben. Gleichzeitig zeichnet sich eine stärker werdende Eigenkulturalisierung in migrantischen Gemeinschaften ab. Innerhalb dieser Gemeinschaften ist der vorherrschende Trend der Identitätspolitiken weit weg von einem emanzipatorischen Anspruch im Sinne einer sozialen und rechtlichen Gleichstellung.
Stattdessen sind vermehrt rückschrittliche Autarkievorstellungen zu beobachten, die einen Rückfall hinter das bürgerliche Recht darstellen. Auch bei der »Islam-Debatte« ist der kulturalistische Rassismus die häufigste Folie für die Auseinandersetzung mit »dem Islam«. Die muslimische Bevölkerung wird nicht als durch die gesellschaftlichen Verhältnisse geprägte Subjekte anerkannt, sondern trotz unterschiedlichster Migrationshintergründe, religiöser Zugehörigkeit (SchiitIn, SunnitIn, AlevitIn, usw.), usw. als »die Moslems« konstruiert. Der Islam erscheint damit als einheitliche Formation, der in all seinen Differenzen und Unvereinbarkeiten ein in sich identisches Wesen trage.
Die Ressentiments gegenüber der muslimischen Bevölkerung bekommen im Vergleich zum völkischen Rassismus der 1990er Jahre eine neue Dimension insofern der völkische Rassismus sich auf Konstruktionen von Volk und Rasse berief, welche scheinbar immer unvereinbar mit dem Gleichheitspostulat der bürgerlichen Gesellschaft waren. Im Vergleich dazu konstruiert die neue Form des antimuslimischen Vorurteils gerade »das Fremde« als den Gegensatz zur bürgerlichen Gesellschaft. Der »Islam« gilt als das zu »Integrierende«, ja sonst womöglich »Terroristische«, gegen das das Selbst in Form des »Westens« und seiner »Errungenschaften« in Stellung gebracht wird. So bieten jene Ressentiments selbst liberalen Kreisen Anknüpfungspunkte für eine offensive Forderung nach Ungleichbehandlung und Aberkennung bürgerlicher Rechte bei MuslimInnen. Die »demokratische Mitte« kann ohne Schwierigkeiten verfassungsmäßige Grundrechte der BRD unter der Losung der Integrationsfähigkeit als Privilegien verteilen und muss sich ihres Zynismus, der sich in dem Abbau und gleichzeitigen Hochhalten dieser Rechte widerspiegelt, nicht vergegenwärtigen. Eine kulturalistische Metamorphose der Gesellschaftsbilder findet statt, in der Individuen samt ihrer Lebenslagen und Probleme zum Schweigen gebracht sind und eine systematische Zuweisung von sozial schlechter gestellten Positionen vollkommen unhinterfragt bleibt. Die verschiedensten sozialen Phänomene werden zu Repräsentanten der homogenisierten Kollektivblöcke (Islam, Westen) verwandelt.
No place to hide for idiots!
Die so genannte Kritik am Islamismus ist meistens überhaupt keine Kritik. Eine radikale Kritik des Islamismus als reaktionärer politischer Bewegung muss im marxschen Sinne des Wortes radikal sein, also den Ansatzpunkt in den gesellschaftlichen Verhältnissen und nicht in den Seufzern (Koran-Versen) verorten. Es geht nicht darum, im Namen einer bedrängten Kultur das Ziel, die Emanzipation des Menschen, zu verdrängen, sondern den Weg dorthin klarer zu sehen. Es bedarf noch nicht einmal des dialektischen Materialismus um zur Auffassung zu gelangen, dass Religiöses in den realen weltlichen Vorgängen zu bewerten und zu kritisieren ist.
Die Theorien, denen Islam als Religion und der Islamismus als politisch-soziale Bewegung einerlei sind, die dadurch den historischen und gesellschaftlichen Gehalt des Islamismus einfach liquidieren, ohne ihn wirklich zu kritisieren, werden außer platter Polemik und Bejubelung aus der falschen Ecke (Nazis usw.) wenig erreichen. Von den islamischen Religionen führt kein notwendiger Weg in die Politik. So lehnen viele Gläubige die direkte Allianz mit der Politik, die sie als Institutionalisierung weltlicher Herrschaft und deren Interessen sehen, um der religiösen Reinheit willen ab.
Der Islamismus ist als politisches Phänomen nur im Kontext eines modernen Nationalismus und in seiner historischen Besonderheit zu erfassen. Erst im Zuge und als reaktionäre Antwort auf die gesellschaftlichen Veränderungen in der Phase des klassischen Imperialismus (Ende 19. / Anfang 20. Jahrhunderts) entwickelte sich der Islamismus. Die transnationale »Umma« wurde die anti-okzidentale Version des »freien Weltenbürgers«. Die Ordnungspolitik des Islamismus im Inneren wie im Äußeren hat seine Entsprechung im verzerrten Spiegelbild des bürgerlichen Staates. Die Popularität gewinnt der Islamismus primär als soziale und nicht als religiöse Bewegung. Er mobilisiert als Sozialbewegung eine gemeinschaftliche Identität, die versucht, jede Individualität auszumerzen. So propagiert der Islamismus eine »organische« Staatsordnung, der an die Stelle von Klassenauseinandersetzungen eine korporativistische Arbeitsdiktatur setzt. Der Koran ist für IslamistInnen sakrosankt, also in keinerlei Hinsicht verhandel- oder relativierbar. Er gilt als das unmittelbar von Gott stammende Wort, als die absolute Wahrheit und somit als einziger Maßstab jedweden Tuns. Somit stellt sich die Formierung des Islamismus zur politischen Bewegung als das Ende der Politik und ihre negative Aufhebung in einer romantisierten, kulturell homogenen Zwangsgemeinschaft (Umma) dar, weil jedwede Relativierung oder Revidierung von Positionen im politischen Kontext als Abweichung und Desertion vom Wort Gottes gilt.
Ebenso gelten die Scharia – die Rechtsbestimmung aus dem Vorderen Orient des achten Jahrhunderts – und die darin fixierten Geschlechterrollen als das wortwörtlich von Gott bestimmte Gesetz. Die Umsetzung dieser durch die Institutionalisierung der Scharia, welche das Ende der sozialen Ungleichheit verspricht, verdeutlicht dabei jedoch nicht die Verwirklichung der Religion Islam. Das konstruierte »Wesen« wird also nicht zum »Dasein«. Stattdessen zeigt es die Krise des Islams als Religion, der gefangen in feudalistischen Normen und Ordnungsvorstellungen längst vergangener Zeiten keine Antworten auf die sozio-ökonomischen Veränderungen (Kolonialismus, Kapitalisierung zuvor feudalistisch organisierter Lebensräume) zu finden vermag.
Die Kritik des Islamismus muss eine Kritik am Rassismus in der Kritik am Islamismus beinhalten; also eine Kritik jenseits des kulturalistischen Mainstreams sein und die Waffe auf jene Verhältnisse richten, die diese reaktionäre Bewegung erst ermöglichten.
Rechtpopulismus meets Neoliberalismus
Klassisch rechtspopulistische Parteien sind und waren in den letzten Jahren an der Macht in mehreren europäischen Ländern. Beispiele sind Berlusconis Bündnis Volk der Freiheit (ODL) oder die Regierungsbeteiligung der FPÖ unter Haider in Österreich. Gleichzeitig generieren sich in Europa immer mehr Politiker durch Polarisierung und rechte Rhetorik, die dem Rechtspopulismus entlehnt ist. Die polnischen Kaczy?ski-Brüder, aber auch Nicolas Sarkozy bedienen sich Methoden des Rechtspopulismus und bekommen reichlich Zuspruch aus den Bevölkerungen. Die rechtsnationale Schweizer Volkspartei (SVP) ist durch den Populismus von Christoph Blocher ebenfalls zur stärksten Partei avanciert. Rechtspopulismus ist somit längst kein Phänomen mehr, das auf (post-)faschistische Parteien oder Bewegungen begrenzbar wäre, vielmehr scheint der Rechtspopulismus, wenn auch noch nicht in der BRD, so doch in Europa ein adäquates Krisenbewältigungs-Konzept für die bürgerliche Ordnung zu bieten. Alle diese verschiedenen Rechtspopulismen in Europa haben ihren Ursprung in den Krisenphänomenen sozialer und ökonomischer Art der letzten Jahrzehnte.
Die Abwendung von Konzepten des Welfare-States, Staatssozialismus oder sozialdemokratischem Korporatismus hin zum so genannten Neoliberalismus hat die Krisen auf politischer und sozialer Ebene verschärft und zu einem Kontroll- und Legitimationsverlust der politischen Systeme geführt. Eine allgemeine Krise traditioneller Parteistrukturen und Gewerkschaften durch den Bedeutungsverlust des Korporatismus und eine stärker werdende Entsolidarisierung verstärken diese Legitimationskrise. Entgegen ihrem Auftreten, ob inhaltlich oder propagandistisch, sind rechtspopulistische Akteure und Strukturen keine Opposition gegen das herrschende System, sondern stabilisierender Faktor. Wie sehr sich auch RechtspopulistInnen anti-elitär präsentieren, ihr Antielitarismus bezieht sich, wenn überhaupt, nur gegen eine »politische Klasse« und nie auf gesamtgesellschaftliche Machtverhältnisse. Gerade die propagandistischen Elemente des Rechtspopulismus wie Nationalismus, Rassismus, Elitarismus und Sozialneid bieten eine verstärkte Bindung an die jeweiligen Nationenkonstrukte. Politische Themen wie Zuwanderungs-Beschränkungen, soziale Ausgrenzung, »innere Sicherheit« oder Anti-Islam und kulturalistischer Rassismus gestatten es, rechtspopulistische Themen im Mainstream zu etablieren. Der Rechtspopulismus ist insofern ein umsichtig modernisierter Rechtsradikalismus in liberaler Erscheinung.
Insbesondere erlaubt der Rückgriff der extrem Rechten in Europa auf politische Theorien der Zwischenkriegszeit und Vorbilder bei der wirtschaftsliberalen amerikanischen Rechten, im Gegensatz zu bisherigen historischen Vorbildern aus dem europäischen Faschismus, den Modernisierungsprozess hin zum Rechtspopulismus und somit zur gesellschaftlichen Relevanz zu vollziehen.
Der Rechtspopulismus bietet die ideologische Verbindung von Wirtschaftsliberalismus und Nationalismus, welche in Zeiten der offensichtlich werdenden sozialen Krise und eines erstarkten Nationalismus sich als zeitgemäßes Gesellschaftsmodell verkaufen lässt. Die Regierungsbeteiligung von Alleanza Nazionale in Italien oder FPÖ in Österreich verdeutlicht, dass (Post)-Faschismus und Rechtspopulismus mit einem neoliberalen Programm verbunden werden können. Dies zeigt, dass es sich beim Rechtspopulismus nicht um eine Gegenbewegung zum neoliberal geordneten Kapitalismus handelt, sondern er sich zum Neoliberalismus komplementär verhält. Die volkstümlich inszenierten Proteste der RechtspopulistInnen gegen das »politische Establishment« sind kein Beleg für den Anspruch der Errichtung einer »Volksgemeinschaft« á la NSDAP, sondern der forcierten Transformation spät-bürgerlicher Ordnung hin zu einer autoritären Staatsordnung, die vermehrt durch sozialdarwinistische Ordnungsstrukturen und rassistische Ausgrenzungsmuster versucht, die soziale Krise zu bewältigen.
In diesem Sinne ist die Kampfansage an die reaktionäre Bewegung des Rechtspopulismus ebenfalls ein Aufruf, die Perspektive der sozialen Emanzipation wieder zum Tagesgeschäft zu machen.
Let´s change the climate!
Dort, wo sich Reaktionäre jedweder Art formieren, gilt es, alle Formen des Widerstandes anzuwenden. Ein Leben ohne Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus und Patriarchat ist nur jenseits der kapitalistischen Verwertungsmaschinerie möglich. Das Leben innerhalb derselben wird immer durch die sachliche Gewalt der kapitalistischen Logik durchdrungen sein und die kritisierten Strukturen und Bewegungen hervorbringen. Dabei bedarf die Kritik der kapitalistischen Produktionsverhältnisse der vermittelnden politischen Praxis, die die radikale Kritik der bestehenden Verhältnisse in all ihren Ansätzen zum zentralen Punkt macht. Daher muss der Widerstand gegen den »Anti-Islamkongress« im Kontext einer Kriegserklärung an jene Verhältnisse, aus denen heraus jene Bewegungen wie die der extremen Rechten überhaupt erst erwachsen konnten, geführt werden.
Wir rufen dazu auf, nicht nur die Waffe der Kritik vom 5. bis 7. September 2008 in Köln bei der Antifa-Debatten-Konferenz »Feel the Difference?!« zu schleifen und die Kritik der Waffen am Wochenende 19. bis 21. September nach Köln zu tragen. Am Abend des 19. September wird unter dem Motto: »Fight the Game! – Rassismus, Nationalismus, Islamismus und Kapitalismus bekämpfen!« die Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen auf die Straße getragen.
Am Samstag den 20. September 2008, rufen wir dazu auf, sich an den Großblockaden vor dem Kongresszentrum zu beteiligen und jede Möglichkeit, die sich bietet, mit allen Aktionsformen zu nutzen, um den RassistInnenkongress zu verhindern.
Wir treten ein für eine Gesellschaft frei von allen Widerlichkeiten wie: Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus, Islamismus und Patriarchat!
Den Aufruf unterstützen: Antifa Mönchengladbach, Antifa Siegen, Antifa Westerwald, Theorie.Organisation.Praxis Berlin (TOP Berlin), Antifaschistische Linke Kitzingen (ALK), Antifa Main-Tauber, AK-Antifa Belzig, Antifaschistische Linke Münster, Alternative Liste Uni Köln, Ökologische Linke Köln, Multikullturelles Zentrum Trier, Kanak Attak, Autonome Antifa Frankfurt, StudentInnen-Ausschuss der Vollversammlung (StAVV-HumF) Uni Köln, attac campus Bochum, redical m, Antifa Lindau, Antifa Lemgo

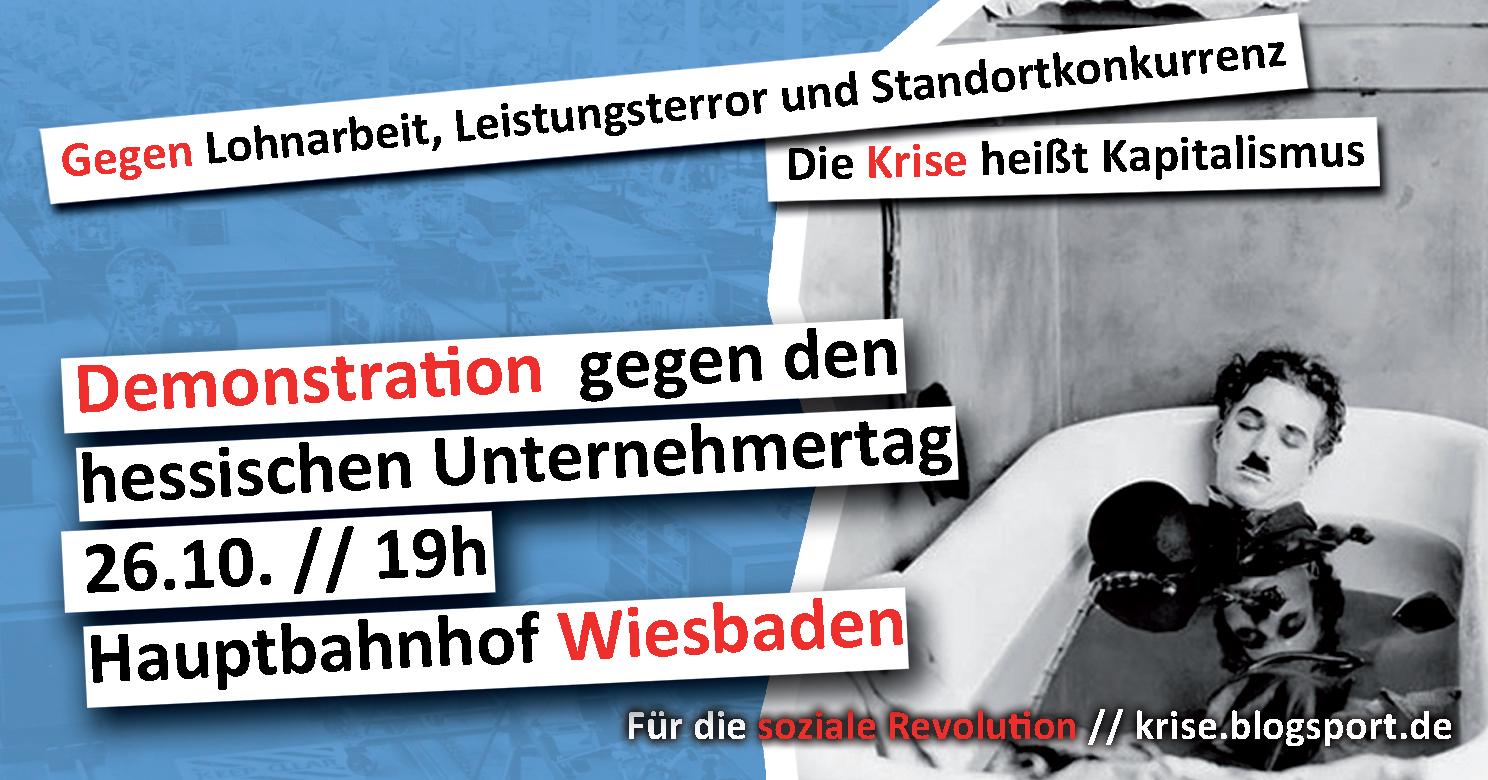
 Die Genoss_innen von der »
Die Genoss_innen von der » Mitglieder des HerausgeberInnenkollektivs werden ihre Motivationen für das Projekt und die damit verbundenen Hoffnungen darlegen, einen Überblick über den Inhalt geben und einzelne, ausgewählte Themenbereiche vertiefen. Vor allem aber soll viel Raum sein, zu diskutieren und sich auszutauschen!
Mitglieder des HerausgeberInnenkollektivs werden ihre Motivationen für das Projekt und die damit verbundenen Hoffnungen darlegen, einen Überblick über den Inhalt geben und einzelne, ausgewählte Themenbereiche vertiefen. Vor allem aber soll viel Raum sein, zu diskutieren und sich auszutauschen!